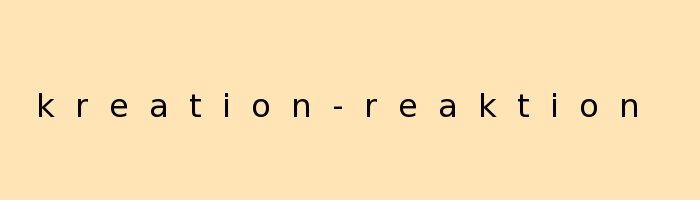Suche
Neu
- Jean Stubenzweig, wo sind Sie? (jagothello, 05.Dez.16)
- Qualität (jagothello, 04.Dez.16)
- Geographische Parallele, mentale Kreuzung (jagothello, 04.Dez.16)
- Schreiben, um zu lernen, was ich denke (Susan... (jagothello, 04.Dez.16)
- Stimmt. Ich bin bei zwei Eigenschaften tatsächlich... (jeeves, 02.Mai.15)
Links
Navigation
Meta
Archiv
- Januar 2026MoDiMiDoFrSaSo12345678910111213141516171819202122232425262728293031
RSS
Wie Lance Armstrong habe ich noch nie eine Tour de france gewonnen. Mit FAZ-Lady Heike Schmoll teile ich das Schicksal, keinen einigermaßen zureichenden Zeitungsbericht über eine Schul- und Bildungsthematik, facettenreich wie der Nachthimmel, schreiben zu können. Weitere Gemeinsamkeiten mit ihr gibt es wohl nicht, denn schon bei solch einer simplen Selbsteinschätzung beginnen die Unterschiede!
a) Grundschulen in Bayern sind die besseren! Ich habe nichts gegen Klischees. Klischees ordnen die Welt und geben Orientierung. Ich gebe auch gerne zu, dass das Bundesland Bayern sich zu vermarkten weiß, obgleich man mit Pressesprechern Kummer gewohnt ist. Identitätsstiftend wirken nicht nur Natur, Getränke, Wohlstand, Kultur und Sprache- sondern eben auch Anspruch und Bewusstsein, besser zu sein. Bildungsstudien belegen das für schulische Bemühungen. Und zwar immer und immer wieder. Andererseits ist mit diesen Studien nicht belegt, dass die guten bayerischen Schulergebnisse auf institutionell angestoßene Schulentwicklungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Vielmehr lehrt die PISA- Studie, dass in Deutschland generell der schulische Erfolg mit dem sozialen Umfeld unanständig hoch korreliert. In einer wirtschaftlich und damit sozial derart prosperierenden Region wie Bayern (für BW gilt das in ähnlicher Art und Weise) wären also andere Ergebnisse geradezu kurios. Wirtschaftspolitik ist Sozialpolitik, heißt es im konservativen Lager. Wirtschaftspolitik ist aber vor allem Bildungspolitik. Auch das gehört zur Debatte, damit der Blick auf die Ursachen des süddeutschen Bildungswunders nicht verstellt wird, Frau Schmoll.
Gymnasiallehrer beklagen eine schleichende Veränderung des Berufsbildes. Ach, Gottchen! Der Gymnasiallehrer: Kannste kein Griechisch, kannste gar nichts. Und Amtsbezeichnungen... Ich bin Gymnasiallehrerin geworden, weil ich keine Lust hatte, kleinen Gören die Nase zu putzen ist sich Frau Oberstudienrätin M aus S nicht blöd genug, Heike Schmoll ins iPhone zu quäken. Vielleicht ist sie aber auch deshalb Gymnasiallehrerin geworden, weil sie mental, fachlich und kognitiv nicht in der Lage war, Biochemikerin am Max-Planck-Institut zu werden oder Abteilungsleiterin beim Klett-Verlag. Wer weiß?! Gymnasiallehrerin ist M aus S aber ganz offenbar nicht geworden, weil sie pädagogisch arbeiten wollte. Heute kann sie es leider nicht mehr, denn die Turnübungen des Referendariats nimmt ja eine gestandene Kollegin nicht ernst und Fortbildungen...? Fortbildungen sind etwas für Leute, die nicht wissen, wo der Hase lang läuft und zu viel Zeit haben. Für Einsteiger und Weichmänner.
Frau Ms. Sache sind eher Anspruch und Dünkel, Dünkel und Anspruch. Bildungsbedarf haben immer die anderen.
Und auch sonst ein Opfer von Missverständnissen, denn Frau M aus S realisiert erst kurz vor der Pensionierung, dass sie keine Fachwissenschaftlerin ist, sondern Lehrerin, Pädagogin, welch garstig Einsicht! Da hilft nur noch die Klage bei der ollen Tante FAZ: Ablativus Absolutus? Vor Klasse 9 geht da doch heute gar nichts mehr!
Die Helden des pädagogischen Alltags aber, liebe M aus S, das sind ohnehin gar nicht Sie, das sind die Förderschullehrer/innen, die Kolleg/innen an den gigantischen Gesamtschulsystemen im Duisburger Norden, in Gelsenkirchen-Schalke, die die Folgen einer völlig verunglückten Integrationspolitik zu beseitigen haben, die pädagogisch nirgends gefilterten Ausflüsse einer jahrelangen CDU-Verhätschelung privater Schundmedien. Die unter einer unsäglichen Diffamierung des Berufsstandes zu leiden haben, sich alltäglich einer politisch billigend in Kauf genommenen sozialen und ökonomischen Verwahrlosung gegenübersehen. Und da ein Pflänzchen zu züchten, Frau M aus S. Da aktiv aus einer G-Kurs Mathematik 4- eine E-Kurs-Mathematik 4 herbeizupädagogisieren und so den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, eine Lebensperspektive zu eröffnen. Dem 14-jährigen Mädchen nicht das verweinte Näschen zu putzen, das müssen Sie in der Tat nicht. Aber es zur Schwangeren-Konfliktberatung begleiten. Lebenshilfe zu geben, mitzufühlen. Das ist A14- Pädagogik. Nicht das, was Sie da machen. Das wird auch gebraucht. Ist aber nicht so schwierig, denn Sie zählen auf stabile Elternhäuser (auf Gentrifizierungsgewinnler, beispielsweise), präparierte Jugendliche, auf Eigeninitiative und generell eine Schülerschaft, die, wäre sie so gestrickt wie Sie sich das vorstellen, Ihrer Berufszunft überhaupt gar nicht bedürfte, denn sie wäre bereits motiviert, klug, intelligent- sie wäre erwachsen und akademisch. Und Ihnen, Heike Schmoll, Ihnen fehlt zu dem Gewäsch dieses Zerrbildes einer ethisch bewegten Lehrkraft Differenz, eine kritische Perspektive, Distanz, mal wieder.
Üben, üben, üben. Ja, natürlich hilft das. Es würde auch helfen, die Sommerferien abzuschaffen. Und es verträgt sich so gar nicht mit dem Bayernmantra, denn jenes betet ja vor, es seien die strukturell entwickelten Maßnahmen, die den Bildungsstandort so weit nach vorne brächten. Und um anderes kann es im Politikteil einer Zeitung auch gar nicht gehen. Ihre Interviewpartner müsste Heike Schmoll in diesem Zusammenhang nach ihrem eigenen Beitrag fragen; wo und wie entwickeln sie ihre Schulen vor dem Hintergrund einer sich verändernden Population? Wo sehen sie ihre eigene Verantwortung? Wie operationalisieren sie pädagogische Konzepte, Standards und Überzeugungen? Mit welchen Technologien erzeugen sie die Bereitschaft und die Fähigkeit, zu üben? Ist ihre Arbeit transparent? Schülernah? ... Professionell? Frau Schmoll?
Entschleunigung und Besinnung verheißt uns der Urlaub. Definiert wird Umfang und Bedarf von demselben Mechanismus, der ihn überhaupt erst erforderlich werden lässt- dem automatisierten Arbeitsprozess. Um dem aufs Neue gewachsen zu sein, nehmen wir die Pause; bleiben also auf Gedeih und Verderb bezogen auf den ökonomischen, volkswirtschaftlichen Aspekt unserer Sozialisation.
Ein dialektischer Gedanke, -Angleichung in der Muße- den Theodor W. Adorno & Max Horkheimer bereits 1944 variieren und auf die sogenannte Kulturindustrie übertragen. Selbstredend geraten da aber noch keine Soaps ins Kreuzfeuer, keine Medienmaschinerien á la RTL, Burda oder die unsäglich infame DEGETO (durchaus aber die großen Hollywood-Studios, die ja noch heute ihr Unwesen im selben Geiste treiben); Adorno/Horkheimer analysieren vielmehr die gesellschaftlichen Funktionen progressiver Jazzmusik, Toscaninis, Hemingways, Beethovens oder Emil Ludwigs; das, was heute als Hochkultur durchgeht. So sehr ändern sich die Zeiten in kurzen Abständen!
Die moderne Rezeption jedenfalls, so das bündige Fazit, bleibt oberflächlich und dem reinen Amüsement verhaftet. Und das mit Folgen: Das Vergnügen erstarrt zur Langeweile, weil es, um Vergnügen zu bleiben, nicht wieder Anstrengung kosten soll und daher streng in den ausgefahrenen Assoziationsgeleisen sich bewegt. Der Zuschauer soll keiner eigenen Gedanken bedürfen: das Produkt zeichnet jede Reaktion vor (...). Jede logische Verbindung, die geistigen Atem voraussetzt, wird peinlich vermieden. (Dialektik der Aufklärung, Fischer 1944/1968, S. 145). Ironischerweise- oder wohl einfach nur in der Logik besagter Dialektik- kommt dem industriell vermarkteten Kulturprodukt dann nicht nur die Aufgabe zu, abzulenken, zu unterhalten. Sinnfällig wird vielmehr eine systemstabilisierende und, ja, vor allem geistraubende, anti-emanzipatorische Funktion am Cartoon: Donald Duck (heute sind es potenziert die Protagonisten all der Casting-Shows, die Verlierer und gescheiterten Existenzen in hunderten scripted-reality- Formaten) (...) wie die Unglücklichen in der Realität erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen.
Und keine weiteren Fragen stellen!, möchte ich ergänzen. Die Methoden haben sich natürlich elegant verfeinert. Überzuckerten, ideologisch verfälschten Beethoven muss heute keiner mehr hören. Denke ich des öfteren, wenn ich beispielsweise einen der hunderte schweren Ausnahmefehler in meinem oktroyierten Leben als homo technologicus zu beheben versuche, die meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit oftmals für Tage einfordern. Meistens geschieht das mit untauglichen, neue Katastrophen verursachenden Mitteln, beinahe immer mit Produkten der steuernden, fehlergenerierenden Internetindustrie und immer mit geistbefreiender Nebenwirkung. Denn welche Ziele noch gleich verfolgt echte Aufklärung? Die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen (ebda. S. 9). Die Adornosche glückliche Ehe des menschlichen Verstandes mit der Natur der Dinge wird aber gewiss nicht in einem der Millionen infantil-verquasselten, viertelgebildeten, nerv- und geisttötenden Internetspielzimmern geschlossen. Hier werden nur Ressourcen geraubt, neue Mythen geschaffen und das Unwissen gepflegt. Was mache ich dort eigentlich?
Gehasst habe ich diese kommerziell orientierten, bequemen, geistlosen Greatest- Hits-Abgreifer; zu faul erschienen mir die, zu wenig ernsthaft, um sich mit dem gebührenden Respekt durch das Werk der Doors zu graben oder woanders über Gustav Mahler zu weinen als an Aschenbachs Venedig- Lido. Suspekt und verachtenswert wie Chemie-Versteher oder Discotheken-Gänger erschienen mir solche Banausen. Bis ich selber einer wurde und einen Teil meiner Selbstachtung verlor. Dem leistete iTunes Vorschub oder meinetwegen das Internet ganz generell. Das ökonomische Charakteristikum der neuen Zeit ist die Portionierung in Premium-Ware. Der Zusammenhang geht dabei völlig verloren. Offenbar auch mir.
Vor diesem Hintergrund kaufte ich nun in grimmiger Stimmung drei Hit-Musik-CDs; immerhin geschmacklich einigermaßen Unangreifbares: Eine Best-of der Who, eine Greatest-Hits der Creedence-Clearwater-Revivals und etwas von Dylan.
Die ersten CD-Käufe seit... na, jedenfalls seit Jahren. Und dabei war ich dereinst so eine Art Pionier des neuen Mediums; als studentischer Mitarbeiter eines recht bedeutenden Musikalienhandels räumte ich den schwarzen Vinyl ins Kellerlager und ersetzte ihn mit diesen kuriosen Silberscheibchen, damals kostbar wie Krügerrands. Ab 36,90 DM (was heute so in etwa einen Gegenwert von 70,-€ entsprechen dürfte!) war der progressive Kunde dabei. Einige Jahre lang existierte das LP- Angebot parallel, quasi zur Absicherung, falls die teure Neuerung sich nicht würde durchsetzen können. Das geschah ja nicht. Ich geriet dennoch kurze Zeit später in den Strudel der Rationalisierung und wurde ohne groß Federlesen zu machen vor die Tür gesetzt. Aber bis dahin sollten noch einige Monate vergehen und wer weiß; hätte es diese glückliche Fügung, und nichts anderes war es, nicht gegeben, wäre ich vielleicht store-manager (Substitut heißt das im Edeka) in diesem oder einem anderen CD- Laden geworden, mit viel Glück nach dem unvermeidlichen Ruin drei Jahre später Hilfsverkäufer im Saturn. Heute würde ich dann mit angegrautem Fusselbart und zu engem schwarzem Hemd Kunden im Flagship-Store abwimmeln, die wegen irgendwelcher Kabel oder Stecker für ihre Eiertechnik aus dem Bergischen Land einfallen. Liebe Elektronik-Fritzen: Ich kenne eure Geschichte!
Die CDs wurden damals jedenfalls nicht einfach in das Geschäft angeliefert. Dafür gab es in diesen frühen Tagen gar keine Infrastruktur. Wir selbst hatten uns um die Distribution zu kümmern, im Gütersloher Zentrallager die Hüllen mit diversen Labeln zu versehen, Bestände aus dubiosen Quellen umzuetikettieren, sie zu ordnen, zu packen und zu verfrachten. Transporte wurde im weißen Golf GTI meines Chefs durchgeführt. Mit beiden Händen klammerte ich mich während des Ritts über die A2 am Haltegriff über der Beifahrertür fest. Ich brauchte das Geld nicht mal. Ich wollte es.
Natürlich gehörte ich auch zu den sehr frühen Player- Betreibern. Ein Monatsgehalt erübrigte ich für einen bildhübschen Denon mit Goldoptikrand, der noch bis vor wenigen Monaten meine Wohnung ästhetisch bereicherte. Heute existiert er nicht mehr aber ich habe Ersatz geschaffen. Denn es gibt ein wiedererwachtes Bedürfnis, Musik in echter, in hoher Qualität zu hören und nicht bloß in simulierter, als Hintergrundeffekt für eigentlich ganz anderes Tun und Treiben am Computer.
Ich weiß schon, dass Mediatheken mittels simpler technischer Bauteile im ganzen Haus abgerufen werden können doch... funktioniert das ja alles nicht. Jedenfalls nicht verlässlich und nicht in der Praxis. Irgendeine Netzwerk- Verbindungs- Anfrage- Problematik liegt eigentlich immer vor, die dann erstmal behoben werden muss, meistens, indem umständlich hässliche Kabelbrücken gebaut werden müssen, von denen auf den Apple-Promotionen, so weit ich weiß, nie die Rede ist. Manchmal, so wie gestern, bricht das ganze fragile Gebilde aus Technik über drei Etagen, zusammengehalten einzig und allein durch ein wenig niederfrequente elektromagnetische Strahlung, rettungslos in sich zusammen. Der Anwender übt im Grunde kaum Kontrolle aus über dieses sich immer feiner spinnende Gewebe aus fluider Dateiexistenz seiner Musik und nur spärlich aufeinander abgestimmter Hardware, verteilt auf den Keller, das Wohnzimmer und Kalifornien. Ich prophezeie dem Gesamtkonzept den baldigen Niedergang!
Und der materiegestützten CD ein grandioses Erweckungserlebnis. Ich fungiere als sein Seismograph, erspüre es bereits deutlich. Und komme sie auch als Best-of-Kompilation daher.