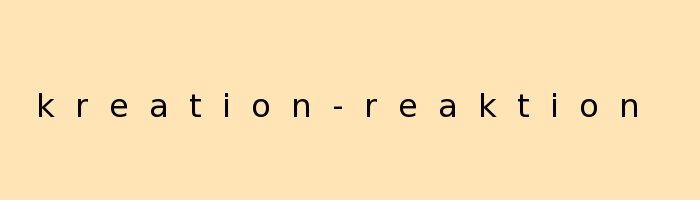Suche
Neu
- Jean Stubenzweig, wo sind Sie? (jagothello, 05.Dez.16)
- Qualität (jagothello, 04.Dez.16)
- Geographische Parallele, mentale Kreuzung (jagothello, 04.Dez.16)
- Schreiben, um zu lernen, was ich denke (Susan... (jagothello, 04.Dez.16)
- Stimmt. Ich bin bei zwei Eigenschaften tatsächlich... (jeeves, 02.Mai.15)
Links
Navigation
Meta
Archiv
- Januar 2026MoDiMiDoFrSaSo12345678910111213141516171819202122232425262728293031
RSS
Dienstag, 3. August 2010
Die schönste Musik der Welt
Die schönste Musik der Welt: das sind die sechs Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach. Behauptet jedenfalls der Berliner Cellist Alban Gerhardt im Interview mit "tip Berlin" und zwar, geschickt, geschickt, just vor seinem Konzert im "Radialsystem" zu Berlin. Die "Bibel des Cello-Spiels" seien diese höchst abstrakten Stücke. Das mag sicherlich so sein- der Cello-Virtuose verweist auf die enorme technische Komplexität dieser Musik. Ich spiele weder Cello noch irgendein anderes Instrument- leider. Ich versinke aber beim Besuch in der Bach`schen Welt regelmäßig in vielfältige Betrachtungen und, durchaus, in einen Zustand entspannter Zufriedenheit. Da ist der Kunst und den Künstlern gedankt. Das muss man ja so erstmal herstellen!
Bemerkenswert an dem Gespräch mit Alban Gerhardt ist aber etwas ganz anderes. Er ist nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass man doch bitteschön über die Musik "nicht schreiben kann, weil Musik da anfängt, wo Sprache aufhört. Wenn man das, was man bei Musik empfindet, in Worte fasst, verliert es (sic) schon sehr viel." Vielleicht hatte Alban Gerhardt einfach keine große Lust, die immer selben Phrasen über seine Passion zum besten zu geben, vielleicht steckt aber doch mehr dahinter. Mich hat das jedenfalls an einige Stunden Lektüre erinnert, die mir kürzlich, einigen Links des Blogs von Jean Stubenzweig folgend, höchst anregend die Zeit vertrieben. Was nicht so alles theoretisiert wird zur Musik!
Erinnert wurde ich aber auch an unseren guten, alten Markus Schwering, Kulturredakteur des Kölner-Stadt-Anzeigers seit langen Jahren, der ebda. mehrmals wöchentlich Rezensionen, Kritiken und Gedanken seine Besuche in den örtlichen Musentempeln betreffend platziert. Ein klitzekleines Beispiel zu einer Chopin-Einspielung Rafal Blechacz`:
. . . [er trifft] den archimedischen Punkt, jene Mitte, die keine noch so raffinierte Brillanz "einfach so" erreicht. Man höre sich nur den Einstieg in den langsamen Satz des zweiten Konzerts an: Das ist lyrisch intensiv, hat großen Atem -- und jenes Equilibrium von schlanker, ritterlicher Eleganz und Melancholie, die Chopins geistiges Zentrum ausmacht. Es stellt sich der Eindruck einer zweiten Natürlichkeit und Herzlichkeit ein --hell, frisch, beschwingt in den Ecksätzen --, die nicht aufgeputzt oder forciert zergrübelt und auch nicht durch übermäßiges Pedal in die titanische Ecke befördert wird. Und wie Blechacz in der Coda des f-Moll-Konzerts den Terzruf des Horns aufnimmt und konsequent durchführt -- das zeigt, wie viel Gestaltungsenergie er jenseits des reinen Spiels mobilisiert.
Ob (andernorts) das Schreiben und Sprechen über die Musik Sinn macht: Ich weiß es nicht sicher. Derart dadaistische Geschwätzigkeit aber möchte ich in meiner Tageszeitung nicht mehr missen. Ist ja gewissermaßen auch eine Kunstform. Und was die schönste Musik nun wirklich ist, kann man ja jeden Tag auf`s Neue entdecken.
Bemerkenswert an dem Gespräch mit Alban Gerhardt ist aber etwas ganz anderes. Er ist nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass man doch bitteschön über die Musik "nicht schreiben kann, weil Musik da anfängt, wo Sprache aufhört. Wenn man das, was man bei Musik empfindet, in Worte fasst, verliert es (sic) schon sehr viel." Vielleicht hatte Alban Gerhardt einfach keine große Lust, die immer selben Phrasen über seine Passion zum besten zu geben, vielleicht steckt aber doch mehr dahinter. Mich hat das jedenfalls an einige Stunden Lektüre erinnert, die mir kürzlich, einigen Links des Blogs von Jean Stubenzweig folgend, höchst anregend die Zeit vertrieben. Was nicht so alles theoretisiert wird zur Musik!
Erinnert wurde ich aber auch an unseren guten, alten Markus Schwering, Kulturredakteur des Kölner-Stadt-Anzeigers seit langen Jahren, der ebda. mehrmals wöchentlich Rezensionen, Kritiken und Gedanken seine Besuche in den örtlichen Musentempeln betreffend platziert. Ein klitzekleines Beispiel zu einer Chopin-Einspielung Rafal Blechacz`:
. . . [er trifft] den archimedischen Punkt, jene Mitte, die keine noch so raffinierte Brillanz "einfach so" erreicht. Man höre sich nur den Einstieg in den langsamen Satz des zweiten Konzerts an: Das ist lyrisch intensiv, hat großen Atem -- und jenes Equilibrium von schlanker, ritterlicher Eleganz und Melancholie, die Chopins geistiges Zentrum ausmacht. Es stellt sich der Eindruck einer zweiten Natürlichkeit und Herzlichkeit ein --hell, frisch, beschwingt in den Ecksätzen --, die nicht aufgeputzt oder forciert zergrübelt und auch nicht durch übermäßiges Pedal in die titanische Ecke befördert wird. Und wie Blechacz in der Coda des f-Moll-Konzerts den Terzruf des Horns aufnimmt und konsequent durchführt -- das zeigt, wie viel Gestaltungsenergie er jenseits des reinen Spiels mobilisiert.
Ob (andernorts) das Schreiben und Sprechen über die Musik Sinn macht: Ich weiß es nicht sicher. Derart dadaistische Geschwätzigkeit aber möchte ich in meiner Tageszeitung nicht mehr missen. Ist ja gewissermaßen auch eine Kunstform. Und was die schönste Musik nun wirklich ist, kann man ja jeden Tag auf`s Neue entdecken.
Montag, 2. August 2010
Hitlers Orgasmen
Adolf Hitler streift durch Wien als mittelloser, 19-jähriger Student der Kunstakademie. Er kann seine Miete nicht zahlen und lebt von der Hand in den Mund. Seine spärlichen Einkünfte, die er als Kofferträger im Bahnhof bezieht, steckt er in seine Garderobe. Ohne halbwegs anständig gekleidet zu sein, lässt man ihn nämlich nicht in die Oper, in der er sich seinen geliebten Wagner-Opern hingibt. Am liebsten Lohengrin, Tristan und Isolde sowie Tannhäuser. Rienzi beeindruckt ihn tief wegen der "Reinheit" des Titelhelden. Adolf ist ein Einzelgänger, tief verunsichert, schüchtern, selbstmitleidig, jähzornig. Frauen gegenüber hat er Komplexe. In der Akademie fällt er in Ohnmacht, wenn sich das Nacktmodell entkleidet. Natürlich ist er "Jungfrau".
Durch den jüdischen Arzt seiner mittlerweile verstorbenen Mutter lernt er Sigmund Freud kennen. Der verspricht, ihn zu therapieren.
Im Zuge der Begegnungen mit Freud lernt Hitler wieder, zu träumen, sich seinen Wünschen, Hoffnungen und Ängsten zu öffnen. Zugang, zu seinem emotionalen Erleben zu finden. Er erkennt, dass der Hass und die Wut auf alles und jeden nichts anderes ist als Selbsthass und Wut auf sich selbst. Z.B. darauf, die Mutter nicht vor den Prügelattacken des grausamen Vaters beschützt zu haben.
Freud deutet einen Traum Hitlers als sexuelle Vision. Der spürt er nun nach. Ausgerechnet besagtes Nacktmodell erbarmt sich seiner und zeigt ihm, wie es geht. Die Beziehung wandelt sich dann bald, denn Hitler lernt viel mehr, als sie beibringt: Er lernt, dass gemeinsame Sexualität nicht nur bedeutet, Orgasmen zu bekommen, sondern, Lust zu geben, zu spenden. Sie verliebt sich in ihn.
Hitler gewinnt Raum. Er nutzt ihn, um nachzudenken, statt wie vorher lediglich die Gedanken schweifen zu lassen. Er erkennt, dass er als Maler nichts taugt, dass seine Wagner-Verehrung nichts zu tun hat mit kulturellem oder geistig- intellektuellem Gewinn, sondern nichts anderes ist als sentimentalische Schwärmerei. Er analysiert die Situation glasklar ohne Schuld bei anderen, z.B. den Professoren, die sein Talent nicht würdigen, zu sehen. Hitler entwickelt Alternativen und wird 30 Jahre später kein satanisches Chaos stiften.
Dieses Fallbeispiel der Menschwerdung eines Menschen bildet den ideellen Kern des Romans "Adolf H. Zwei Leben" von Eric-Emmanuel Schmitt. Parallel dazu erzählt Schmitt die Geschichte des zweiten Lebens, des historischen des Adolf H., in dem es keine bestandene Aufnahmeprüfung an der Akademie, keine Begegnung mit der Psychoanalyse, keine Therapie, keine Reflektionen und keinen ehrlichen, echten menschlichen Kontakt gab.
Schmitt schildert in einem Nachwort seine Motive, der seelischen und moralischen Degeneration Hitlers nachzuspüren. Seine zugrunde liegende These ist, dass es eine Wahl gibt, Entscheidungsfreiheit, Ich oder Gegen-Ich zu werden. Es steht uns auch unter ungünstigen Startbedingungen frei, Mensch zu werden und Menschlichkeit auszubilden. Mehr noch: Es ist Pflicht.
Dem Verstehenwollen haftet an, erklären und somit gleichzeitig entschuldigen zu können. Da ist es natürlich viel einfacher, den Verbrecher und seine Verbrechen zu determinieren als Produkt seiner Umwelt, der Geschichte. Schmitt sieht das, hat die Diskussion wohl auch geführt. Sein Hitler bleibt jedenfalls schuldig, weil er sich aktiv von den Bedürfnissen anderer abkapselt; weil er sich aktiv für einen Egozentrismus entscheidet, der dezidiert die Bedürfnisse seiner Mitmenschen vernachlässigt.
In seinem Buch "Der Verlust des Mitgefühls" bestätigt der schweizer Psychoanalytiker Arno Gruen übrigens jede Zeile des Schmitt' schens Gedankenexperimentes. Am Beispiel diverser KZ-Täter werden die Motive von Gewaltexzessen zurückgeführt auf ganz ähnliche Mechanismen wie bei Schmitt beschrieben. Bücher, die in den Amazon-Warenkorb zumindest eines jeden pädagogisch tätigen Menschen gehören.
Durch den jüdischen Arzt seiner mittlerweile verstorbenen Mutter lernt er Sigmund Freud kennen. Der verspricht, ihn zu therapieren.
Im Zuge der Begegnungen mit Freud lernt Hitler wieder, zu träumen, sich seinen Wünschen, Hoffnungen und Ängsten zu öffnen. Zugang, zu seinem emotionalen Erleben zu finden. Er erkennt, dass der Hass und die Wut auf alles und jeden nichts anderes ist als Selbsthass und Wut auf sich selbst. Z.B. darauf, die Mutter nicht vor den Prügelattacken des grausamen Vaters beschützt zu haben.
Freud deutet einen Traum Hitlers als sexuelle Vision. Der spürt er nun nach. Ausgerechnet besagtes Nacktmodell erbarmt sich seiner und zeigt ihm, wie es geht. Die Beziehung wandelt sich dann bald, denn Hitler lernt viel mehr, als sie beibringt: Er lernt, dass gemeinsame Sexualität nicht nur bedeutet, Orgasmen zu bekommen, sondern, Lust zu geben, zu spenden. Sie verliebt sich in ihn.
Hitler gewinnt Raum. Er nutzt ihn, um nachzudenken, statt wie vorher lediglich die Gedanken schweifen zu lassen. Er erkennt, dass er als Maler nichts taugt, dass seine Wagner-Verehrung nichts zu tun hat mit kulturellem oder geistig- intellektuellem Gewinn, sondern nichts anderes ist als sentimentalische Schwärmerei. Er analysiert die Situation glasklar ohne Schuld bei anderen, z.B. den Professoren, die sein Talent nicht würdigen, zu sehen. Hitler entwickelt Alternativen und wird 30 Jahre später kein satanisches Chaos stiften.
Dieses Fallbeispiel der Menschwerdung eines Menschen bildet den ideellen Kern des Romans "Adolf H. Zwei Leben" von Eric-Emmanuel Schmitt. Parallel dazu erzählt Schmitt die Geschichte des zweiten Lebens, des historischen des Adolf H., in dem es keine bestandene Aufnahmeprüfung an der Akademie, keine Begegnung mit der Psychoanalyse, keine Therapie, keine Reflektionen und keinen ehrlichen, echten menschlichen Kontakt gab.
Schmitt schildert in einem Nachwort seine Motive, der seelischen und moralischen Degeneration Hitlers nachzuspüren. Seine zugrunde liegende These ist, dass es eine Wahl gibt, Entscheidungsfreiheit, Ich oder Gegen-Ich zu werden. Es steht uns auch unter ungünstigen Startbedingungen frei, Mensch zu werden und Menschlichkeit auszubilden. Mehr noch: Es ist Pflicht.
Dem Verstehenwollen haftet an, erklären und somit gleichzeitig entschuldigen zu können. Da ist es natürlich viel einfacher, den Verbrecher und seine Verbrechen zu determinieren als Produkt seiner Umwelt, der Geschichte. Schmitt sieht das, hat die Diskussion wohl auch geführt. Sein Hitler bleibt jedenfalls schuldig, weil er sich aktiv von den Bedürfnissen anderer abkapselt; weil er sich aktiv für einen Egozentrismus entscheidet, der dezidiert die Bedürfnisse seiner Mitmenschen vernachlässigt.
In seinem Buch "Der Verlust des Mitgefühls" bestätigt der schweizer Psychoanalytiker Arno Gruen übrigens jede Zeile des Schmitt' schens Gedankenexperimentes. Am Beispiel diverser KZ-Täter werden die Motive von Gewaltexzessen zurückgeführt auf ganz ähnliche Mechanismen wie bei Schmitt beschrieben. Bücher, die in den Amazon-Warenkorb zumindest eines jeden pädagogisch tätigen Menschen gehören.
Freitag, 30. Juli 2010
Gerold Becker
Über den Tod hinaus langt der Spott, die ätzende Abrechnung, die wütende Replik auf den Gestrauchelten. Sicher: da gibt es die Verwerflichkeit der Tat, das Monströse des tiefen Abgrunds. Es gibt aber auch den niedrigen Beweggrund des Chronisten, denn wenig nur hassen (oder lieben) wir mehr als den allzu klaffenden Widerspruch zwischen moralischer Attitüde und ungezügelter, hedonistischer Triebhaftigkeit. Den Fall des Lichtengels: der ist es, den wir sehen wollen. Wir? Ja, so sind wir Deutschen! So bin ich!
Gerold Becker, kürzlich verstorbener, ehemaliger Leiter des durchaus elitären, jedenfalls höchst erfolgreichen pädagogischen Reformprojekts "Odenwaldschule" und Missbraucher vieler der ihm anvertrauten Kinder, ließ sich zum Nutzen kooperativer Lernformen im Unterricht anno 1992 so vernehmen:
"Es gibt (...) bestimmte, elementare Erfahrungen, die ein Mensch gemacht haben muß, um als Sechsjähriger oder als Sechzehnjähriger für wirkliches, das heißt verstehendes und die Person veränderndes Lernen in einem schulischen Kontext überhaupt offen zu sein."
Angesichts der schweren Vorwürfe gegen Becker und seiner Eingeständnisse im o.b. Sinne liest sich das natürlich in ganz anderem Lichte, als es zunächst aufgefasst wurde. Auf "bestimmte, elementare Erfahrungen" jedenfalls hätten die Opfer Beckers, vornehmlich Jungen, sicherlich gerne verzichtet.
Soweit das Apercuhafte. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich übrig bleibt vom pädagogisch- intellektuellem Vermächtnis Beckers angesichts der ethischen (Selbst-) Demontage. Die Pädagogik ist ja in den Augen vieler sowieso eine verdächtige, reichlich vage Disziplin, deren normativen Setzungen einigermaßen willkürlich daherzukommen scheinen. Wie sollen die aber nun noch Bestand haben können, wenn schon ihre Setzer sich als derart unzuverlässig und angreifbar zeigen? Gerold Becker hat auch seinem Metier, seiner "Fakultät" schweren Schaden zugefügt.
Gerold Becker, kürzlich verstorbener, ehemaliger Leiter des durchaus elitären, jedenfalls höchst erfolgreichen pädagogischen Reformprojekts "Odenwaldschule" und Missbraucher vieler der ihm anvertrauten Kinder, ließ sich zum Nutzen kooperativer Lernformen im Unterricht anno 1992 so vernehmen:
"Es gibt (...) bestimmte, elementare Erfahrungen, die ein Mensch gemacht haben muß, um als Sechsjähriger oder als Sechzehnjähriger für wirkliches, das heißt verstehendes und die Person veränderndes Lernen in einem schulischen Kontext überhaupt offen zu sein."
Angesichts der schweren Vorwürfe gegen Becker und seiner Eingeständnisse im o.b. Sinne liest sich das natürlich in ganz anderem Lichte, als es zunächst aufgefasst wurde. Auf "bestimmte, elementare Erfahrungen" jedenfalls hätten die Opfer Beckers, vornehmlich Jungen, sicherlich gerne verzichtet.
Soweit das Apercuhafte. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich übrig bleibt vom pädagogisch- intellektuellem Vermächtnis Beckers angesichts der ethischen (Selbst-) Demontage. Die Pädagogik ist ja in den Augen vieler sowieso eine verdächtige, reichlich vage Disziplin, deren normativen Setzungen einigermaßen willkürlich daherzukommen scheinen. Wie sollen die aber nun noch Bestand haben können, wenn schon ihre Setzer sich als derart unzuverlässig und angreifbar zeigen? Gerold Becker hat auch seinem Metier, seiner "Fakultät" schweren Schaden zugefügt.