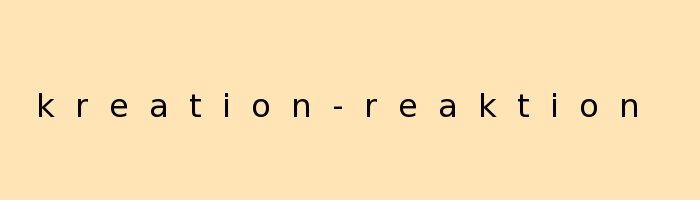Suche
Neu
- Jean Stubenzweig, wo sind Sie? (jagothello, 05.Dez.16)
- Qualität (jagothello, 04.Dez.16)
- Geographische Parallele, mentale Kreuzung (jagothello, 04.Dez.16)
- Schreiben, um zu lernen, was ich denke (Susan... (jagothello, 04.Dez.16)
- Stimmt. Ich bin bei zwei Eigenschaften tatsächlich... (jeeves, 02.Mai.15)
Links
Navigation
Meta
Archiv
- Oktober 2011MoDiMiDoFrSaSo123456789101112141516181920212324262728293031
RSS
Ich war nie so recht ein Freund des Martin Walser. Mir kommen seine Prosa-Predigten immer arg gestelzt daher, konventionell im Erzählstil und dröge im Plot. Ich sympathisiere mit der Einschätzung Reich-Ranickis, das sei eigentlich gar keine Literatur, was der Bäckerssohn da verzapfe. Eher konzeptionelle Reflektionen über dies und das, gerne ja auch einmal mit Anleihen in naturwissenschaftlicher Sphäre.
Umso anregender für mich nun ein Interview, welches der Bodensee-Priester anlässlich des herbstlichen, mehr und mehr seltsamen Literaturtreibens in Frankfurt dem lokalen Werbe-Blättchen (Top Medium im Bereich regional print) gewährte. Walser bezeichnet sich selbst dort als Muttersohn. Das sei seine treffliche Charakterisierung. Er verwahrt sich gegen Muttersöhnchen und konstatiert, dass es nur Deutschen einfalle, die enge Bindung an die Mutter mit hämisch-höhnischer Verniedlichung zu belegen. Mir gefällt der Gedanke, dass ein Wortsetzer tagelang über solch semantische Details sinniert.
In seinem nächsten Buch, so erfährt der devote Fragenmensch, wird Gott gesucht und... nicht gefunden- was sonst! Würde er gefunden... ja, das wäre mal was. Ich sehe ein: das brächte so einen Autor natürlich in schier unüberwindliche dramaturgische Schwierigkeiten. Trotzdem, ich bleibe dabei: Man läse solches einmal gerne: Wir standen nebeneinander an der Sandwich-Theke und ich erklärte IHM umständlich, wie ein Sub bestellt wird. Entgeistert besah ER sich die schmierige Zutaten und bröseligen Brotfragmente. So in der Art.
Nach Lektüre Karl Barths und Augustinus´ fühlt jedenfalls M.W. sich inspiriert zu einem theologischen Stoff, weil deren Theologie der Hoffnungslosigkeit geeignet sei, Trost zu spenden und spirituelle Bedürfnisse aufgeklärter Menschen zu befriedigen. An Gott glauben, aber jede Hoffnung fahren lassen: Das klingt vielversprechend. Vielleicht doch noch mal Zeit, sich predigen zu lassen.
«Ich schätze die Hoffnungslosigkeit der Romantiker, die Politisiertheit der Romantiker. Ich halte Novalis für einen ausgesprochen scharfen Denker.
Eine Arbeit wie die von Jean Paul, in der er alle Utensilien in seinem Zimmer notiert, ist beeindruckend. Es ist klar, daß da eine Panne im Programm ist. Der Künstler hat ‹nichts› mehr zu sagen. Die Kunst verläßt den Kontext, für den sie geschaffen war. Der Auftrag ist zu Ende, das Programm ist aus. Daß die Kunst auch der Kurzschluß ihres Systems sein kann, das hat mich beeinflußt. In der Romantik kommt es zur Panne des Auftrags, eigentlich ein schöner Moment, unglaublich scharf und ohne jede Entschuldigung. Scharfgestellt wird auf die Kunst, und was da steht, nackt und alleine, das ist eben die Kunst. Die Kunst ohne Dauer, Publikum, Auftrag. [...] Das ist auch politisch. Das entspricht einem fast französischen Begriff des Politisierten [...]. Das allerwichtigste: daß sie eine relativ würdige, unexpressive Haltung eingehalten haben des totalen Fehlens von Anlaß zu Hoffnung. Die Romantiker waren total getrennt von ihrer Liebe, ihrer Sehnsucht, ihrem Verlangen nach Ursprung oder Zukunft, von ihrem eigenen Bewußtsein, von ihrem Programm, und ohne zu klagen und zu lamentieren und ohne sich zu verbohémisieren haben sie das ausgehalten.»
«Das Sprechen führt den Zug der zeitlichen Dinge an wie ein tanzendes Kind mit einem Wimpel, auf dem nichts geschrieben steht, oder etwas, das es weder weiß noch versteht, oder mit Kinderschrift: Tod. Deshalb folgt die Kunst in dem Zug der zeitlichen Dinge weit hinten nach, mürrisch. Sie träumt von der Gegendemonstration.»Jochen Gerz
Brentano fand alles (Jen- und Diesseits) so freundlich verbunden, Hoffnungslosigkeit spüre ich da ganz und gar nicht, erst recht keine religiöse Abkehr. Eher eine gewisse Desillusioniertheit in Bezug auf die klassischen Sujets der Epoche, Liebe und Sehnsucht.
Wohlan! so bin ich deiner los
Du freches, liederliches Weib!
Fluch über deinen sündenvollen Schoß
Fluch über deinen feilen geilen Leib,
Fluch über deine liederlichen Brüste (...)
Und auch Heine entfernt sich, sicherlich sehr, sehr spät vom Klischee des vom Tode faszinierten Galans und Jenseitsritters:
Nur einmal noch möcht´ich dich sehen,
Und sinken vor dir auf die Knie,
Und sterbend zu dir sprechen:
Madame, ich liebe Sie!
Man mag solches politisch finden, warum nicht. Alles und nichts ist irgendwie ein Statement. Vielleicht ist auch "nicht hoffen" nicht so weit entfernt von "frustriert sein"; morbid aber sind diese Leute nicht gewesen.
Und gerade Heine, dessen Loreley heutzutage viele den melacholischen Wein-Rhein entlang hinuntersingen und es meist nicht bis zur letzten Strophe schaffen oder sie gar nicht kennen, in der es heißt:
«[...] Ich glaube, die Wellen verschlingenViele wissen überhaupt nicht, wie der zwischendrin aufschäumen konnte, wenn er ans liebe Mütterlein dachte und bei Leichen landete:
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.»
[...] Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr,Um sich anschließend wieder romantisch in die Beleuchtung im zwölfjährigen Exil in Feindesland hineinzudenken:
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.
Seit ich das Land verlassen hab',
So viele sanken dort in's Grab,
Die ich geliebt — wenn ich sie zähle,
So will verbluten meine Seele.
Und zählen muß ich — Mit der Zahl
Schwillt immer höher meine Qual,
Mir ist, als wälzten sich die Leichen
Auf meine Brust — Gottlob! Sie weichen!
Gottlob! Durch meine Fenster brichtAus Heines Nachtgedanken, von ihm aufgeschrieben zu einer Zeit, für deren Raum die Literaturwissenschaft den Grabgesang für die deutsche Romantik angestimmt hat, während die französische noch ein bißchen weiterleben durfte.
Französisch heit'res Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.
Und es vermag mich, das nebenbei, durchaus beeindrucken, solche politischen Gedanken eines Schülers zu lesen:
«Aufgrund dieses Gedichts kann ich die Menschen besser verstehen, die wegen politischer Motive in unserm Land um Aufnahme bitten. Ihnen ergeht es sicher so wie Heine, dass ihnen die Verwandtschaft fehlt und ihre Seele wegen den undemokratischen Zuständen im Heimatland weh tut.»
www.loehrschule.de/files/graf/Gedichtinterpretation%20Nachtgedanken.pdf
Ich halte es im übrigen für verfehlt, Heine als «Überwinder der Romantik» zu bezeichnen, wie das immer wieder geschieht. Er ist meines Erachtens zeitlebens immer ein Romantiker geblieben, zumindest einer, der eben nicht alles, wie heute üblich, verklärend, sondern diese Epoche durchaus als Bewegung gesehen hat, in der schlicht nichts als endgültig gedacht wurde, alles offenblieb, unter anderem die Hoffnung. Romantik ist aus dem Roman entstanden. Novalis schrieb: «Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung [...]. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem gewöhnlichen ein geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.» Das ist als Abziehbildchen von der Romantik übriggeblieben, wenn in der Kontaktanzeige vom romantischen Abendessen bei Kerzenschein (vorm elektrisch betriebenen Flackerkamin) und einem Strauß roter Rosen (aus dem bald totgespritzten Afrika) die Buchstaberei kapriolt. Heine hat, in meiner Sichtweise, seinerzeit lediglich darauf verwiesen, daß es unterschiedliche Perspektiven gibt.
Das wiederum könnte auch daran gelegen haben, daß er im Sinn jüdischer Aufklärung aufgewachsen ist, aus dem der Begriff entstanden sein dürfte, den mir gegenüber zum ersten Mal Anfang der neunziger Jahre Yaacov Agam aussprach, der mir seither nie mehr aus dem Kopf gegangen ist und der zumindest inhaltlich immer mehr Verbreitung zu finden scheint: Kulturjude, also jemand, der sich weniger aus der Religion nährt als aus dem kulturhistorischen Umfeld.
Ach herrje, beinahe wäre mein Überlebensfluß Logorrhoe wieder über die Ufer getreten. Ich hatte viel mehr geschrieben, war bereits mal wieder ausufernd bei christlich-jüdisch angelangt und wollte gerade zum katholischen Glauben übergehen. Aber gerade noch rechtzeitig ist mir eingefallen, daß ich solche Ausschweifungen alleine innerhalb meiner elektrischen Logkladde zulassen sollte. So komme ich möglicherweise zuhause nochmal auf die Romantik zurück – quasi als Erinnerungsarbeit (in den Einflüssen der französischen Aufklärung auf die deutsche Romantik habe ich vor vierzig Jahren auf den Dachböden der vergleichenden, hier roman(t)ischen Literaturgeschichte gegraben [meine letzte ernsthafte Tätigkeit]. Vielleicht wühle ich also bei mir mal wieder in alten Schriften.